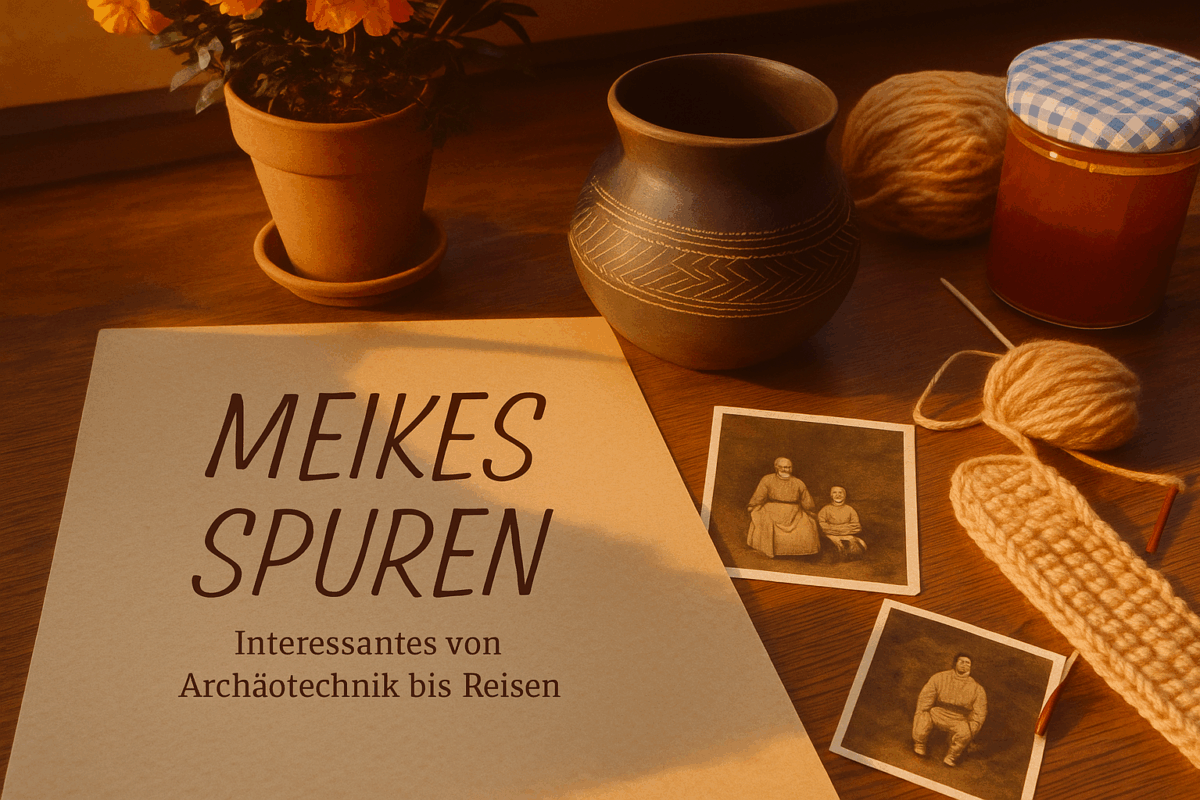Wer mich kennt, weiß: Ich liebe kleine Küchenexperimente – besonders, wenn sie einen Bezug zu früheren Zeiten haben.
Schon während der Palafitfood-Challenge haben wir mit der AG Lebendige Archäologie ein erstes Rinderdörrfleisch ausprobiert – ganz schlicht, nur mit Salz, Thymian und viel Geduld. Das Ergebnis war wunderbar aromatisch und erstaunlich nah an dem, was in der Vorgeschichte möglich gewesen wäre. Wer es nachlesen möchte: Thymian-Rinder-Dörrfleisch ist weiterhin auf der Palafitfood-Seite zu finden.
Monat: November 2025
Kelten, Germanen und Römer in Mittelhessen
Ende Oktober habe ich das Alte Rathaus in Lohra besucht und mir dort einen faszinierenden Vortrag angehört. Der Geschichtsverein Lohra präsentierte Dr. Armin Becker (Archäologischer Park Xanten) der uns auf eine archäologische Zeitreise durch Mittelhessen führte – von den Kelten über die Römer bis zu den Chatten, die später als mögliche Namensgeber der Hessen gelten.
„Kelten, Germanen und Römer in Mittelhessen“ weiterlesen🌞 Tante Dele – Mein Sonnenschein
Wenn ich in alten Kisten wühle, ahne ich selten, dass sie mir den Atem rauben werden.
Doch an einem Abend im Oktober geschah genau das.
Zwischen vergilbten Fotos und vergessenen Briefen tauchte sie wieder auf – meine Urgroßtante Adele Jäger, die alle nur „Tante Dele“ nannten.
Eine Frau, die mich als Baby noch gekannt hat, die mich zärtlich „mein kleiner Sonnenschein“ nannte – und deren Lebensspuren mich nun plötzlich mitten ins Herz trafen.