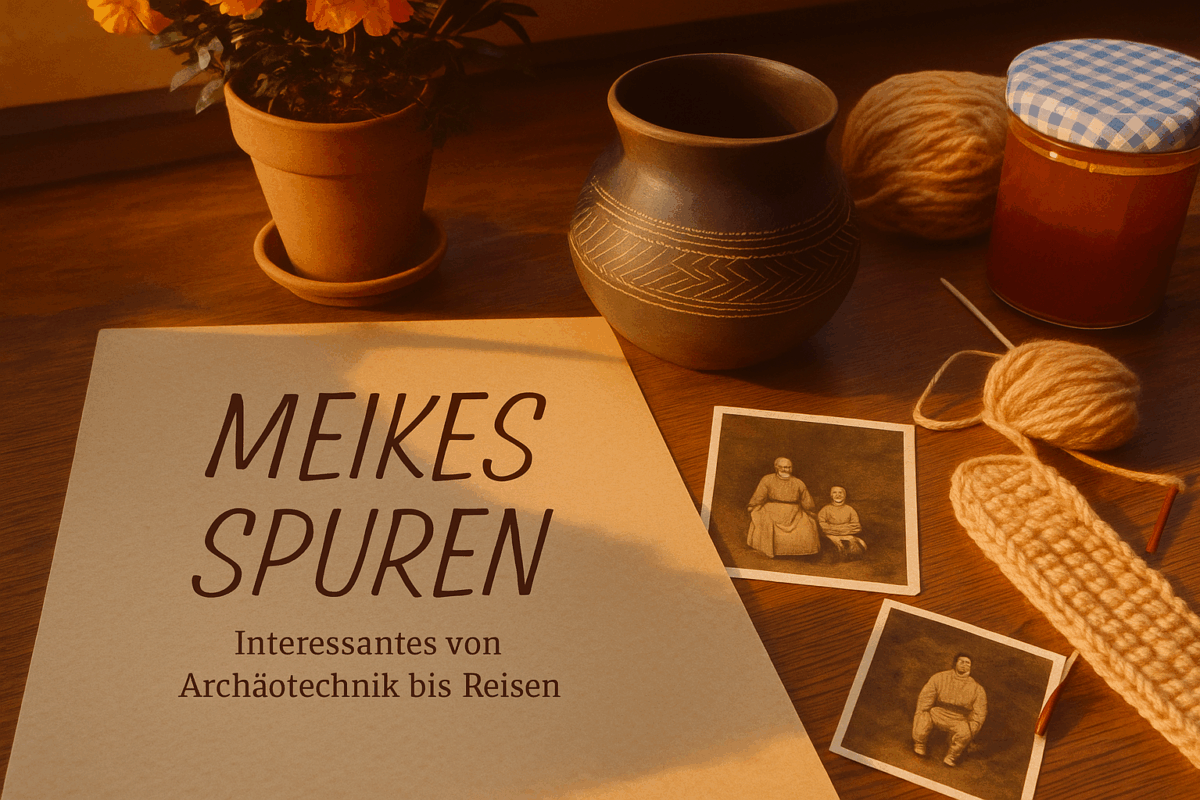Ende Oktober habe ich das Alte Rathaus in Lohra besucht und mir dort einen faszinierenden Vortrag angehört. Der Geschichtsverein Lohra präsentierte Dr. Armin Becker (Archäologischer Park Xanten) der uns auf eine archäologische Zeitreise durch Mittelhessen führte – von den Kelten über die Römer bis zu den Chatten, die später als mögliche Namensgeber der Hessen gelten.
Bereits in der Hallstattzeit, also der älteren Eisenzeit, war der mittelhessische Raum eine Kontaktzone zwischen Kulturen: zwischen den ersten Bauern in der Wetterau und den letzten Jägern und Sammlern im Norden, zwischen Kelten, Germanen und später Römern. Besonders eindrucksvoll wurde gezeigt, dass Hessen in der Spätlatènezeit – der jüngeren Eisenzeit – zum Kerngebiet der keltischen Oppida gehörte.
Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Dünsberg bei Gießen, eines der größten keltischen Siedlungszentren der Region.
Mit der römischen Expansion unter Cäsar und Augustus verlagerte sich das Geschehen zunehmend an den Rhein und in die Wetterau. Zahlreiche römische Marschlager, etwa bei Limburg oder Hermeskeil, belegen die strategische Bedeutung des Gebiets. Die Römer drangen weit nach Germanien vor – und errichteten schließlich bei Waldgirmes an der Lahn die erste römische Stadt östlich des Rheins.

Die Ausgrabungen dort sind spektakulär: Fachwerkbauten auf steinernen Fundamenten, ein kleines Forum, Reste einer vergoldeten Reiterstatue und Hinweise auf eine geplante Stadtanlage, die nie vollendet wurde. Vermutlich endete das Projekt mit den Ereignissen des Jahres 9 n. Chr., der Varusschlacht. Waldgirmes wurde später planmäßig aufgegeben – ein Hinweis darauf, dass Rom den Traum einer Provinz bis zur Elbe aufgab.
Nach der Varusschlacht blieb das Rhein-Main-Gebiet jedoch nicht verlassen. Römische Lager in Südhessen zeigen, dass das Reich die Region weiter beobachtete und sogar germanische Gruppen als Grenzwächter ansiedelte. Im 1. Jahrhundert kam es zu mehreren Konflikten, unter anderem zu den Chattenkriegen unter Domitian (83–85 n. Chr.), die zur dauerhaften Sicherung der Wetterau führten. In dieser Zeit entstand auch der Limes, dessen Verlauf bis heute durch archäologische Befunde und Dendrochronologie – etwa an der Rätischen Mauer (206–207 n. Chr.) – genau datiert werden kann.
Der Vortrag spannte den Bogen bis ins 3. Jahrhundert, als unter Kaiser Caracalla (211–217 n. Chr.) erneut Feldzüge gegen Germanen stattfanden. In den römischen Quellen tauchen Begriffe wie „Germanicus Maximus“ und „per limitem Raetiae“ auf, die auf seine Aktivitäten am Limes hinweisen. Funde wie das Limestor von Dalkingen oder goldverzierte Inschriften (Litterae aureae) belegen die römische Präsenz in dieser Zeit.
Im nördlichen Hessen kam es schließlich zu Kämpfen, die man heute archäologisch am Harzhorn nachweisen kann – Spuren eines bislang unterschätzten Gefechts, bei dem römische Truppen offenbar von Süden kommend einen germanischen Angriff abwehrten.
Abschließend wandte sich der Referent der Frage zu, ob die Chatten tatsächlich die Vorfahren der Hessen seien. Zwar zeigen Siedlungen in Mittelhessen seit dem 2. / 3. Jahrhundert eine kontinuierliche Besiedlung, doch es gibt keinen sicheren sprachlichen oder ethnischen Zusammenhang zwischen den Chatti der Antike und den Hessi aus den Bonifatiusbriefen des 8. Jahrhunderts.
Die Gleichsetzung beider Gruppen entstand erst im 17. Jahrhundert, als die Landgrafschaft Hessen-Kassel begann, sich eine heroische Vergangenheit zu schaffen.
Der Vortrag schloss mit einem eindrucksvollen Fazit:
Hessen war nie ein Randgebiet, sondern seit der Vorgeschichte ein Zentrum des Austauschs, in dem sich über Jahrtausende Kulturen begegneten, überlagerten und veränderten – ein faszinierender Blick auf die tiefe Vergangenheit unserer Region.