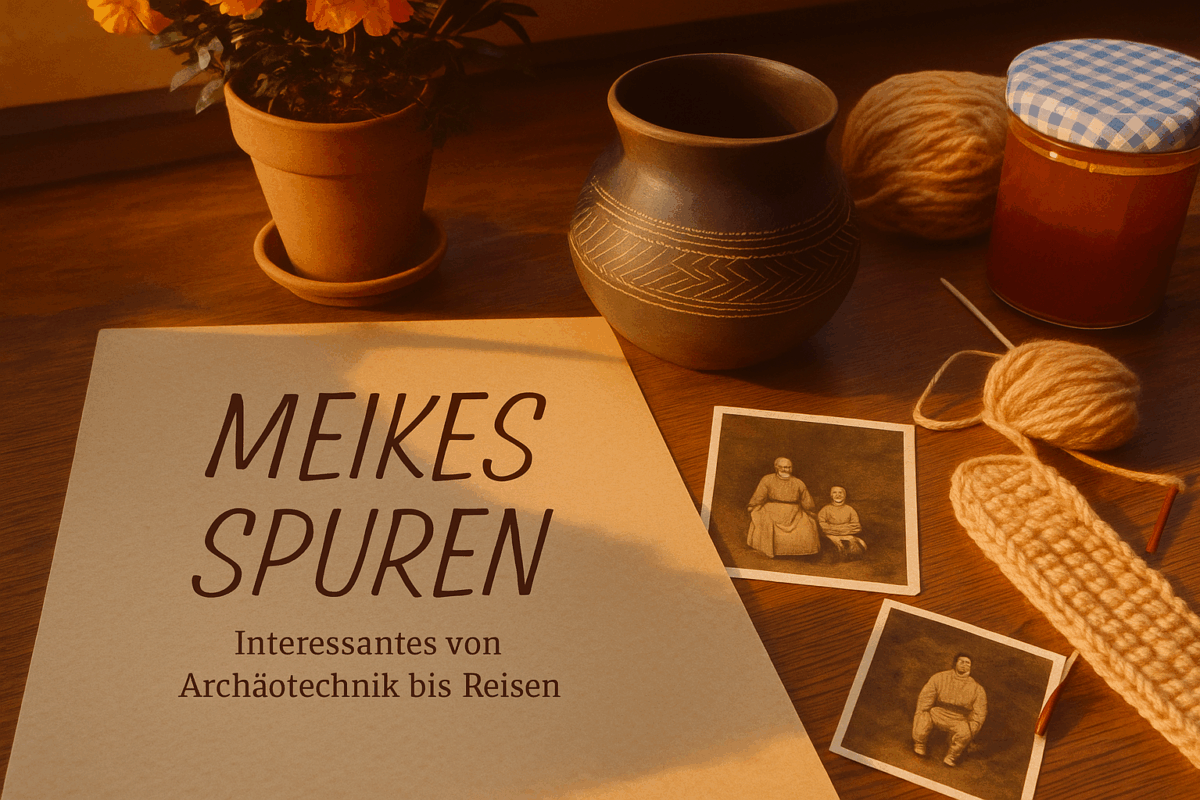Keramikbrand ohne Ofen
Der Meilerbrand ist eine der ältesten bekannten Methoden, Keramik zu brennen. Er kommt ohne geschlossenen Ofen aus und nutzt stattdessen die Hitze eines kontrollierten Holzfeuers, das über mehrere Stunden aufgebaut, verdichtet und schließlich luftdicht abgeschlossen wird.
🔹 Aufbau und Vorbereitung
Die Tongefäße werden zunächst langsam vorgewärmt, um Temperaturschocks zu vermeiden. In der Regel geschieht das am Rand der vorbereiteten Brandgrube oder auf einer feuerfesten Unterlage über einem offenen Feuer.
Ist der Ton gleichmäßig erhitzt, werden die Gefäße in die Mitte der Grube gestellt. Oft werden sie dabei innen mit Blättern, Stroh oder Rindenstücken gefüllt, um beim späteren Brand eine Schwarzfärbung der Oberfläche zu erzielen. Zum Schutz vor direktem Flammenkontakt werden empfindliche Stücke gelegentlich mit alten Scherben oder Tonplatten abgedeckt.
🔹 Der Brand
Rund um die Gefäße wird anschließend ein Feuerkranz gelegt, der schrittweise in die Mitte geschoben wird. Durch das Nachlegen von Holz entsteht eine gleichmäßig ansteigende Hitze, die die Gefäße von außen nach innen durchglüht.
Nach einigen Stunden intensiver Hitze wird der Meiler mit feuchten Blättern, Rinde und Erde bedeckt.
Dieser Schritt nennt sich Reduktion: Durch den verminderten Sauerstoffzufluss entstehen im Ton charakteristische graue bis schwarze Färbungen, oft mit schönen Flammen- oder Wolkenmustern.
🔹 Abkühlung und Ergebnis
Der Meiler bleibt anschließend viele Stunden, manchmal über Nacht, geschlossen. Während dieser Zeit sinkt die Temperatur langsam ab. Erst am nächsten Tag wird die Grube vorsichtig geöffnet.
Das Ergebnis sind unverwechselbare Keramiken mit natürlichen Farbverläufen, matten Oberflächen und einem sehr ursprünglichen Charakter.
Kein Stück gleicht dem anderen – jedes ist ein Zeugnis des Zusammenspiels von Erde, Feuer und Zufall.