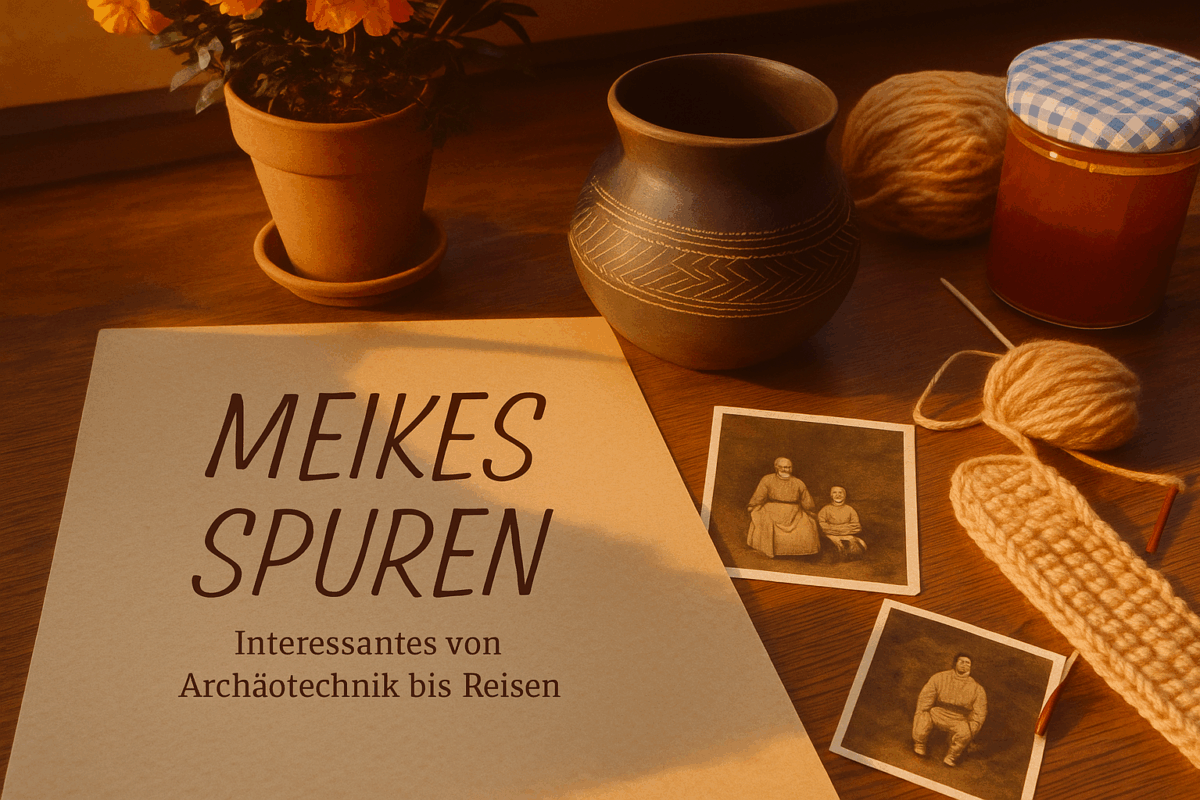Die ältesten Keramiken entstanden ohne Drehscheibe – allein durch die Geschicklichkeit der Hände.
Auch auf der Zeiteninsel wird in dieser traditionellen Technik gearbeitet: Gefäße entstehen aus Tonwürsten, die spiralförmig übereinandergesetzt und anschließend mit den Fingern oder einem glättenden Werkzeug miteinander verstrichen werden.
So wächst ein Gefäß langsam Schicht für Schicht empor – ganz ohne maschinelle Hilfe, nur durch Gefühl und Erfahrung.
Ich arbeite ausschließlich mit dieser Aufbaukeramik-Technik, da sie den handwerklichen Charakter und den unmittelbaren Kontakt zum Material bewahrt.
Eine weitere einfache, aber wirkungsvolle Methode ist das Daumenschalen-Verfahren:
Aus einer kompakten Tonkugel wird mit dem Daumen die Wandung ausgedrückt und in kleinen, gleichmäßigen Bewegungen erweitert. Auf diese Weise entstehen kleine Schalen oder Becher – jede Form ein Unikat, das die Handschrift der Person trägt, die es geformt hat.
Das Drehen auf der Töpferscheibe wurde in der Marburger Region erst mit den Römern eingeführt und blieb lange Zeit unüblich.
Damit steht die Aufbaukeramik ganz in der Tradition der vorgeschichtlichen Gefäßherstellung, bei der Geduld, Gefühl und Rhythmus des Arbeitens im Mittelpunkt stehen.
Werkzeuge – einfache Mittel, große Wirkung
Beim Arbeiten mit Ton braucht es erstaunlich wenig Werkzeug.
Viele meiner Hilfsmittel sind schlicht oder selbst hergestellt – Holzspatel, Knochenspatel, Kieselsteine, Poliersteine oder kleine Tonscherben.
Mit ihnen lassen sich Oberflächen glätten, Kanten formen oder Gefäße in die gewünschte Gestalt bringen.
Auch flache Hölzer helfen dabei, gleichmäßige Wandungen zu erzielen.
Zum Verzieren verwende ich gern Naturmaterialien: kleine Muscheln, Knöchelchen, Pflanzenteile oder auch Strohhalme, mit denen sich feine Linien, Punkte oder Strukturen eindrücken lassen.
Diese einfachen Werkzeuge erzeugen lebendige Muster – jedes anders, jedes einzigartig.
Bei bestimmten Gefäßformen nutze ich Formschalen, um den Ton während des Aufbaus zu stützen.
Damit das Material dabei nicht austrocknet oder anhaftet, lege ich feuchte Tücher dazwischen – eine kleine, aber wirkungsvolle Hilfe, die sich seit Jahrhunderten bewährt hat.
Ich orientiere mich bei der Auswahl meiner Werkzeuge an archäologischen Vorbildern, kombiniere sie aber mit praktischen Lösungen, die sich für das Arbeiten im Freien oder im Arbeitszimmer bewährt haben.
So bleibt der Charakter des Handwerks sichtbar: Jede Spur, jede Druckstelle erzählt etwas über die Art und Weise, wie das Gefäß entstanden ist.